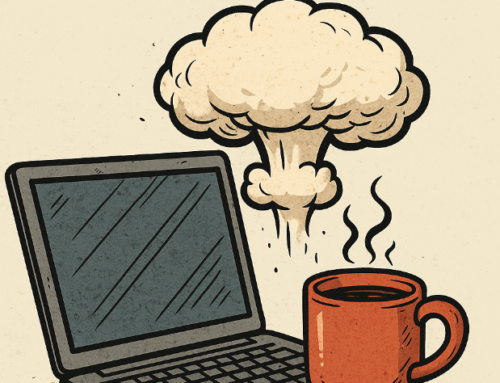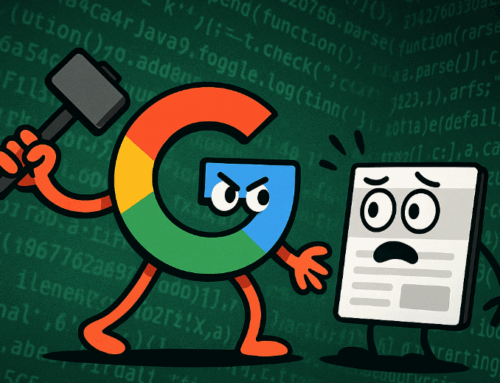Nach langer Zeit komme ich endlich wieder zum Schreiben, und es geht um eine Sache, die meine Kunden und mich in den vergangenen Wochen sehr beschäftigt hat: Google. Seit Jahren gilt der Konzern als unverzichtbare Plattform für Online-Sichtbarkeit. Egal, ob Nachrichtenseiten, Online-Shops, Blogs oder Einzelunternehmer – wer im Netz gefunden werden will, muss sich dem Google-System unterordnen.
Was früher als Suchmaschine begann, hat sich inzwischen zu einem komplexen Ökosystem entwickelt, das Inhalte nicht nur vermittelt, sondern selbst produziert, kontrolliert und vermarktet. Mit dem Start der neuen KI-Suche (Search Generative Experience, kurz SGE) erreicht diese Entwicklung einen kritischen Punkt.
Vom Vermittler zum Alleinherrscher
Google dominiert mit einem Marktanteil von rund 90 Prozent weltweit die Internetsuche. In Deutschland liegt der Anteil bei über 93 Prozent (Statcounter, 2024). Diese Marktmacht bedeutet faktisch ein Monopol. Wer dort nicht sichtbar ist, existiert für den großen Teil der Internetnutzer nicht. Was jedoch zunimmt, ist nicht die Sichtbarkeit für Vielfalt, sondern die Selbstreferenzialität des Konzerns.
Schon heute verlinkt Google bei vielen kommerziellen Suchanfragen bevorzugt auf eigene Dienste: Google Maps, YouTube, Google Shopping, Google Flights. Damit verdrängt das Unternehmen nicht nur Wettbewerber, sondern auch kleine und unabhängige Anbieter. Die neue KI-Suche verschärft dieses Problem massiv.
Googles KI-Suche als Reichweitenfalle
Stellt ein Nutzer eine Frage, liefert Google durch SGE eine direkt eingeblendete Antwort – erzeugt durch Künstliche Intelligenz, basierend auf fremden Inhalten. Diese Inhalte werden automatisiert zusammengefasst, ohne dass die Quellen prominent genannt werden. Sichtbarkeit entsteht nicht mehr durch die eigene Seite, sondern durch Googles Interpretation der Inhalte. In vielen Fällen ist der einzige ausgehende Link in der Antwort ein Google-eigener: zu Maps, zu YouTube oder zu einem Google-Produkt.
Für Content-Produzenten, Redaktionen oder Shopbetreiber bedeutet das: Ihre Inhalte werden zwar genutzt, aber nicht mehr honoriert. Kein Traffic, keine neuen Nutzer, keine Reichweite – obwohl genau dieser Content das Fundament für Googles neuen Services bildet.
Google verspricht zwar, Quellen einzubinden und Inhalte transparent zu machen. Die Realität sieht jedoch anders aus: Die meisten Nutzer klicken nicht mehr weiter, wenn die Antwort direkt vor ihnen steht. Und wenn doch, landen sie nicht selten wieder bei einem Google-Dienst. So entsteht ein geschlossener Informationskreislauf, der Google nützt, aber allen anderen schadet.
Die wirtschaftlichen Folgen für kleine Anbieter
Für viele kleine und mittlere Online-Projekte sind Google-Suche und Google Discover entscheidende Traffic-Quellen. Doch diese Kanäle sind nicht stabil. Sichtbarkeit in Discover ist unberechenbar: Manchmal erscheint ein Artikel tausendfach in den Feeds, manchmal bleibt er unsichtbar. Eine klare Logik ist nicht erkennbar, offizielle Kriterien fehlen. Wer auf Discover-Traffic angewiesen ist, lebt in ständiger Unsicherheit.
Dazu kommt: Wer Google Ads nutzt, sieht sich häufig mit intransparenten Empfehlungen, steigenden Klickpreisen und aggressiven Budgetvorgaben konfrontiert. Die Plattform überlässt die Kontrolle immer stärker ihren Algorithmen und entzieht den Werbetreibenden gleichzeitig Einblick und Steuerungsmöglichkeiten.
Besonders problematisch ist das für Selbstständige, kleine Shops und unabhängige Medien. Sie verfügen weder über große Budgets noch über eigene Entwicklerteams, die sich durchgehend an Googles Vorgaben anpassen könnten. Zwar sagt der Konzern, man solle für die Leser schreiben, aber schaut man sich das Ranking an, dann sieht es nicht danach aus. Immer mehr skalierte Webseiten/Artikel, die Klicks und damit Einnahmen generieren sollen. Viele kleine Anbieter verlieren schlicht die Möglichkeit, überhaupt noch sichtbar zu sein, während Google mit ihren Inhalten weiter profitiert.
Ein Fall für die Regulierung
Google ist längst kein neutraler Mittler mehr, sondern ein wirtschaftlicher Akteur mit maximalem Eigeninteresse. Die Kombination aus Marktmacht, Datenhoheit und struktureller Intransparenz macht das Unternehmen zu einem systemrelevanten Faktor – nicht nur für die Werbewirtschaft, sondern auch für die Informationsverbreitung und Meinungsbildung.
Es braucht daher dringend politische Gegenmaßnahmen:
- Transparenzpflichten für algorithmische Entscheidungen in Suche und Discover
- Verpflichtende Quellenkennzeichnung und Trafficbeteiligung bei KI-generierten Antworten
- Begrenzung der Selbstverlinkung in Suchergebnissen
- Fairer Zugang zu Sichtbarkeit für kleine Anbieter
- Klare Richtlinien für die Nutzung fremder Inhalte in KI-Systemen
Dass diese Regulierung möglich ist, zeigt ein Blick in andere Bereiche: Plattformen wie Meta wurden im Rahmen des Digital Services Act bereits zu mehr Transparenz verpflichtet. Auch Google fällt unter diese Regulierung – doch die konkreten Umsetzungen bleiben bisher oberflächlich. Die Durchsetzung muss ernst gemeint sein, nicht nur symbolisch.
Die Digitalisierung darf kein Einbahnstraßensystem sein, das Inhalte zentralisiert, aber deren Schöpfer ignoriert. Wenn Suchmaschinen zu geschlossenen Ökosystemen werden, verlieren wir nicht nur wirtschaftliche, sondern auch demokratische Vielfalt.